
(v.l.n.r) Oliver Dahm, Wolf Eisentraut und Ingo Malter. Foto: Jenny Schindler
“Berlin baut auf. Berlin sind wir. Die neuen Häuser, die sind dein und mein, wir alle wollen Hausherrn sein.” Besagte Zeilen aus dem Lied “Was ist denn an der Weberwiese los?” sind inzwischen etwa 60 Jahre alt, aber dennoch bis heute aktuell. Das Hochhaus an der Weberwiese war einst als Symbol für den Aufbau des Sozialismus in der DDR gedacht, der Architekt Hermann Henselmann war an dessen Planung und Umsetzung beteiligt. Beim ersten Abendsalon der gleichnamigen Hermann-Henselmann-Stiftung durfte das Lied entsprechend nicht fehlen, zumal dessen Text jene Grundprobleme Berlins so treffend umfasst, mit denen die Großstadt seit Jahren zu kämpfen hat. Wobei sich bereits hier die Geister zu scheiden beginnen, worin die Herausforderungen für den städtischen Wohnungsmarkt konkret bestehen. “Wohnungsgeschrei” nannte dies der Architekt Professor Wolf Eisentraut mit leicht ironischem Unterton.
Neubau ja – aber durchdacht
Fest steht immerhin: Berlin erlebt derzeit einen Boom an Zuwanderung, allein mehrere Zehntausend in den letzten drei Jahren. Bezahlbarer Wohnraum, besonders in innerstädtischen Bezirken wie Mitte und Friedrichshain-Kreuzberg, wird zur Mangelware. Die Bevölkerungsprognose des Berliner Senats rechnet bis 2030 mit einem weiteren Bevölkerungszuwachs von rund 250.000 Menschen. Als Antwort darauf schreien alle Parteien nach einem deutlichen Zuwachs an Neubau. Allein mit Horrorzahlen wird die Debatte allerdings bereits kompliziert, wie die LINKEN-Expertin für Stadtentwicklung Katrin Lompscher anhand einiger weiterer Statistiken belegte. Neubau gab es in Berlin auch in den letzten 20 Jahren, allerdings “haben wir ganz offensichtlich am Bedarf vorbeigebaut”, wie Lompscher einräumt. Schuld
daran sind nicht zuletzt ungenaue Prognosen, wie die frühere Senatorin erklärt. Ob der Boom an Zuwanderern tatsächlich anhält, könne niemand mit Sicherheit sagen. “Die Attraktivität der Stadt ist kurz und mittelfristig hoch. Mehr können wir nicht sagen”, so Lompscher. Schon in der Vergangenheit lag der Senat mit seinen Schätzungen allerdings oft deutlich daneben. Mal waren die Zahlen zu hoch, dann wieder zu niedrig angesetzt. Womit niemand so richtig rechnete, war der deutliche Anstieg an Singlehaushalten, deren Zunahme sich fast automatisch auf die Anzahl der Gesamthaushalte auswirkt. “Haushaltsprognosen will kein Statistiker voraussagen. Doch ohne diese Prognose gibt es keine verlässlichen Wohnraumprognose”, erklärte die Politikerin das städtebauliche Dilemma. Doch wie neue Wohnungen planen, wenn man die theoretischen Grundlage dafür nicht zur Verfügung hat? Selbst wenn man einigermaßen sichere Werte besäße, ist Neubau per se noch kein Allheilmittel, da sich nach Lompschers Angaben etwa 2/3 der Berliner die Miete nicht ohne Unterstützung durch den Staat leisten könnten. Reiner Wild vom Berliner Mieterverein sieht dies ähnlich. “Das jetzige Angebot an Neubau ist zu fast 90 Prozent im teuren Preissegment angesiedelt”, bemerkte Wilde. Aktuelle Bauprojekte seien mit im Schnitt 115qm je Wohnung viel zu groß. Gebaut wird, aber nur für das obere Drittel der Berliner Gesellschaft.
Quadratmeter nicht unter zehn Euro
Ohne Förderung oder eine Mischfinanzierung geht beim Thema Neubau ohnehin nichts, zumindest wenn man Stadtentwicklung sozialverträglich gestalten will. Eine neu gebaute Wohnung sei seriös finanziert für unter zehn Euro je Quadratmeter nicht zu haben, rechnete der Architekt Oliver Dahm anhand eigener Bauprojekte vor. Die Baukosten je Quadratmeter lägen inzwischen bei 1300 bis 1400 Euro, sofern man auf jegliche Extravaganz verzichtet. “Quadratisch, praktisch, gut ist eben günstiger”, meinte Dahme. Bauförderung nach dem Gieskannenprinzip sei jedenfalls
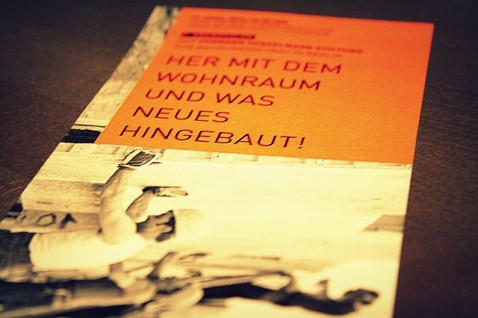
Im Juni diskutiert die Henselmann-Stiftung bei ihrem nächsten Salon die Frage, wie wir uns das Wohnen in Zukunft leisten können. Foto: Jenny Schindler
gescheitert, behauptete Ingo Malter, Geschäftsführer der Wohnbautengesellschaft Stadt und Land. Seiner Ansicht nach müsste man die Mieten für Sozialschwache senken und gleichzeitig die Preise für wohlhabende Bewohner eines Wohnhauses anheben. “Damit hätten wir keine Gentrifizierung mehr”, erklärte Malter. Ob der Vorschlag, der u.a. schon mehrfach von Bausenator Michael Müller (SPD) immer wieder in die hitzige Debatte der letzten Monate eingebracht wurde, in vielen Stadtteilen Berlins überhaupt noch Wirkung zeigen würde, bleibt indes fraglich.
Dass der Platz für neue Hausprojekte in Berlin ausreichend vorhanden sei, sagte Stefanie Frensch, Geschäftsführerin der HOWOGE. Die städtische Wohnungsgesellschaft will bis 2015 etwa 1500 Wohnungen bauen. Platz dafür gäbe es innerhalb zahlreicher Baulücken, durch Nachverdichtung oder auf den Geländen alter Brachen. Fragt sich nur, wer sich das bei den durchschnittlich eher niedrigen Einkommen vieler Haushalte leisten soll, mahnte ein Zuhörer aus dem Publikum. Welche Möglichkeiten diesbezüglich bestehen, wird der nächste Abendsalon der Henselmann-Stifung im Juni diskutieren.
(Text: Robert D. Meyer, Bilder: Jenny Schindler)






